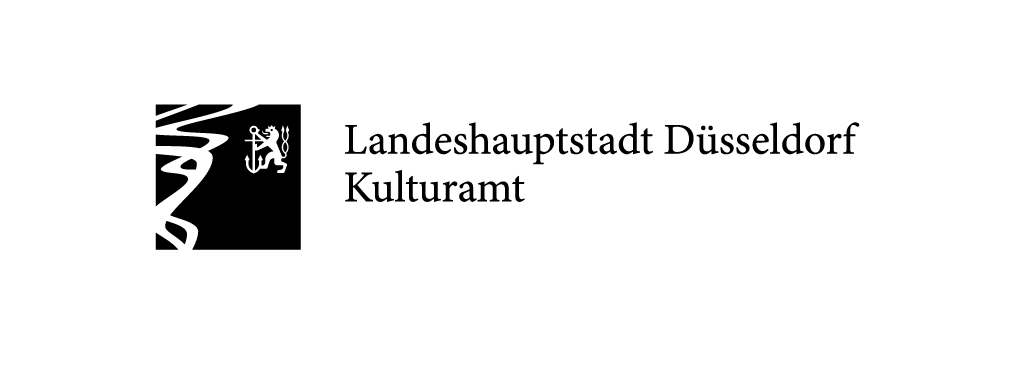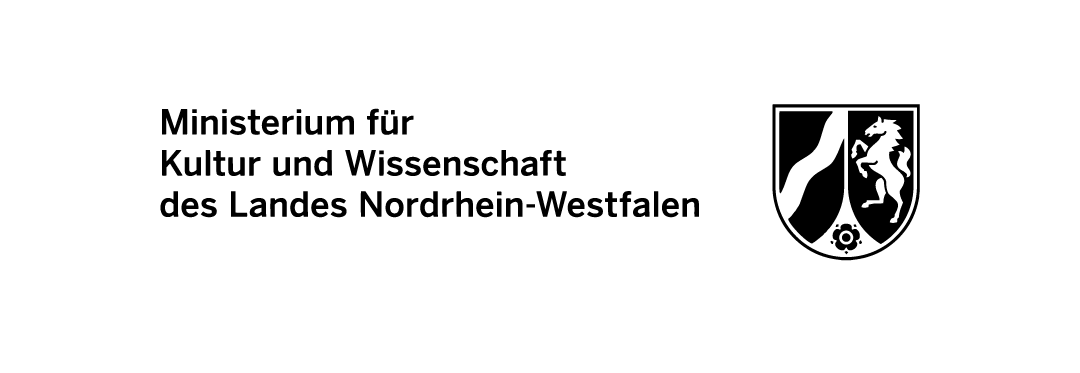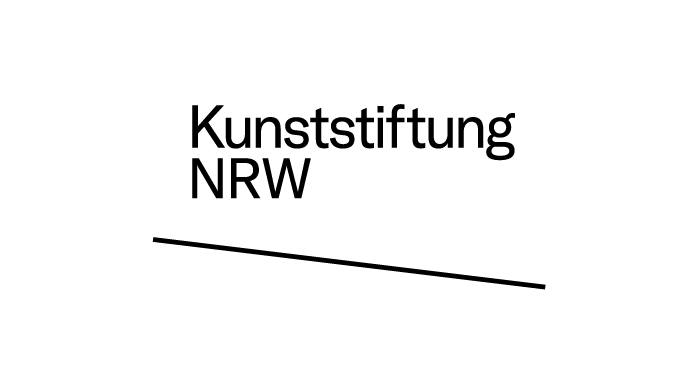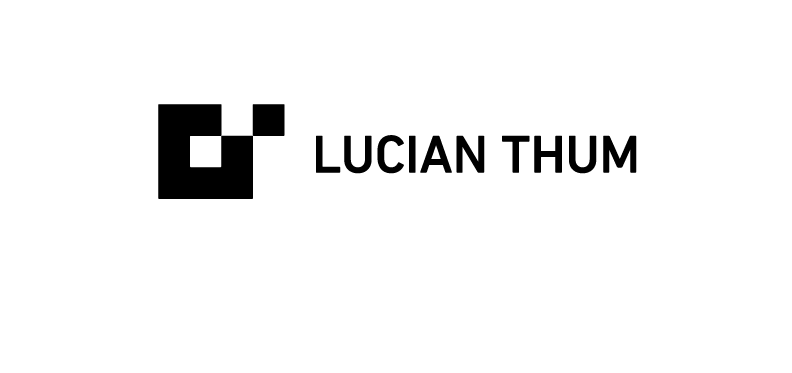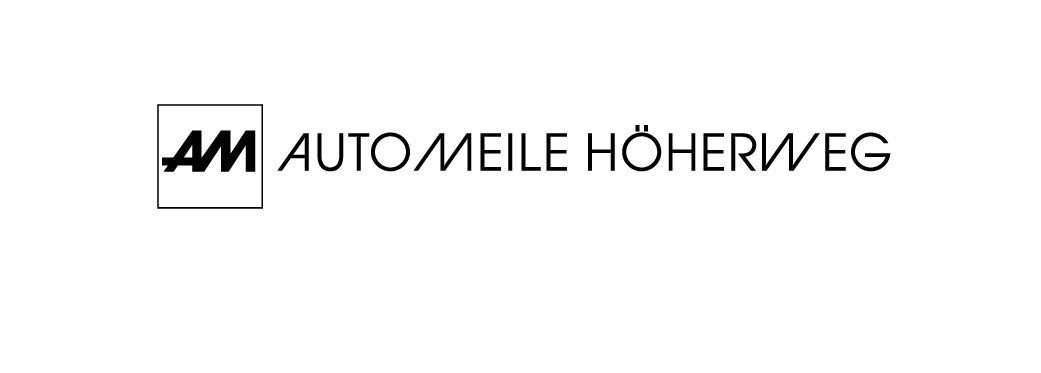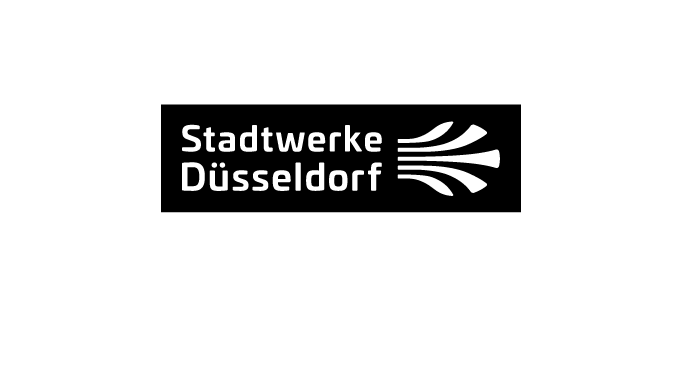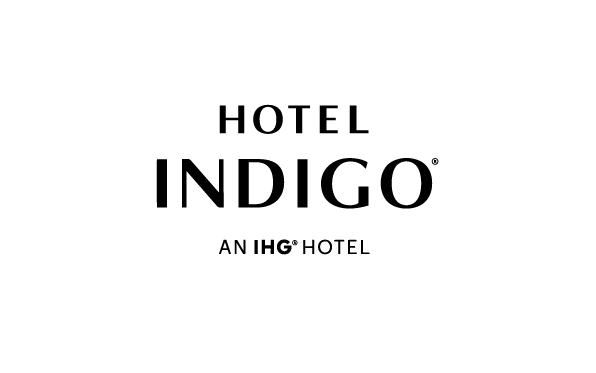von Halyna Kruk
Die mehrfach preisgekrönte ukrainische Schriftstellerin und Poetin Halyna Kruk hat bei asphalt 2023 eine bewegende Festivalrede über den Stellenwert von Kunst und Literatur in Zeiten des Krieges gehalten. Wir dokumentieren ihre Rede im Wortlaut. Übersetzung aus dem Ukrainischen von Beatrix Kersten.
– 23. Juni 2023
.
.
.
Halyna Kruk wurde 1974 in Lwiw geboren. Die mehrfach preisgekrönte Lyrikerin, Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin ist Autorin von fünf Gedichtbänden, einer Sammlung von Kurzgeschichten und mehreren Kinderbüchern. Ihre Werke wurden in mehr als dreißig Sprachen übersetzt und in verschiedenen Gedichtbänden, Zeitschriften und Anthologien in vielen Ländern veröffentlicht. Kruk war von 2017 bis 2019 Vizepräsidentin des ukrainischen PEN und hält eine Professur für Literaturwissenschaft an der Universität von Lwiw, wo sie europäische und ukrainische Barockliteratur lehrt.

»Vor einem Jahr habe ich die Eröffnungsrede zum Poesiefestival in der Akademie der Künste in Berlin mit den Worten beschlossen, es täte mir leid, dass Dichtung nicht tötet. Diese Rede wurde Programm. In viele Sprachen übersetzt, wurde sie in vielen Ländern verbreitet. Wo auch immer es mich danach hin verschlug, war mein Verlangen nach einer Dichtung, die tötet, Anlass für Gespräche und Interviews. Mein Bedauern darüber, dass Poesie kein Werkzeug der Strafe, noch nicht einmal ein Mittel zur Selbstverteidigung sein kann, wurde in den wohlhabenden europäischen Ländern überwiegend als etwas Bedrohliches wahrgenommen, etwas, das die Konventionen sprengt. Weil man doch in der zivilisierten Welt seit Generationen nach Kräften bemüht ist, sich Regeln und Gesetze für ein friedliches Zusammenleben zu geben und auf deren Einhaltung zu dringen, rote Linien zu ziehen, die im Sinne des Gemeinwohls nicht überschritten werden dürfen. Aggression wird nicht toleriert, Krieg hinter die Einfriedungen der europäischen Zukunft verwiesen, ja, vor die Tore der zivilisierten Welt.
Und plötzlich stellte sich heraus, dass dieses Verdrängen und Unter-den-Teppich-Kehren von Aggression nicht nur nicht funktioniert, sondern schlimmer noch – auch keine Unterscheidung mehr zulässt zwischen Aggressor und Opfer, sie beide gleichermaßen hinter die Grenzwälle verbannt, den, der angreift und den, der sich verteidigt. Siedelt man beides fernab jeder Normalität an und betrachtet es aus sicherer Distanz, hört man ab einem gewissen Punkt auf zu differenzieren, wer angefangen hat, und wem nichts anderes übrigblieb, was Ursache war und was Folge. Wenn Russland mit dem Begriff »Pazifizierung« operiert, klingt das für eine gebildete Person mit Lateinkenntnissen im kulturellem Background nach »Befriedung«, es klingt nach »Friedfertigkeit« und friedlicher Ruhe, nach etwas, das einen sanft einlullt wie der »Pazifische«Ozean und politisch so korrekt ist wie »Pazifismus.« Wir beurteilen andere immer gemäß unserer eigenen Weltwahrnehmung und anhand der Wegmarken unseres Wertesystems. Darum haben auch die Ukrainer bis zur letzten Minute nicht an einen umfassenden russischen Angriff geglaubt, weil sie den Maßstab ihres eigenen Landes, eines liberalen, demokratischen europäischen Landes anlegten, das die Logik und Aggressivität eines imperialen Eroberungskriegs nicht nachvollziehen kann.
Der europäische Pazifismus will in der russischen »Pazifizierung« etwas ihm Geistesverwandtes erkennen, sie als eine, zugegebenermaßen mit einem etwas brutalen, kolonialen Beigeschmack versehene Methode sehen, die aber doch zum hehren Ziel des Friedens führt. Der europäische Pazifismus will aus der Losung »Wir sind gegen Krieg« der im Zuge des Kriegs emigrierten Russen etwas Richtiges heraushören, für sich Anschlussfähiges darin entdecken, und erwartet ähnliche Aussagen auch von Ukrainern. Auf der Ebene der reinen Begrifflichkeit bin ich, wenn ich nicht erkläre, »gegen Krieg« zu sein, konsequenterweise »für Krieg«. Auf dieser Ebene wird ja nicht einbezogen, dass es, wenn die Ukraine »gegen Krieg« wäre, zwar keinen Krieg mehr gäbe, aber auch eben auch keine Ukraine. Krieg ist aber doch ein Schrecknis, das alles zerstört, was die Menschheit an Menschlichem aufzubieten hat, Psyche, Umwelt, Wirtschaftsbeziehungen, durchweg alles. Und so legt man uns nahe, doch lieber ein Abkommen zu erzielen, die andere Wange hinzuhalten, ein Auge ein Auge, einen Zahn einen Zahn sein zu lassen und aufzugeben, was Russland an ukrainischen Gebieten erobert hat und besetzt hält. Einer muss doch der Klügere sein, so sagt man uns.
Eine gute und menschliche Ermahnung ist das, die wir alle wohl mehr als einmal als Kinder von einer liebenden Mutter gehört haben, wenn wir etwas nicht mit unseren Geschwistern teilen wollten. Die Mutter Europa liebt uns beide gleichermaßen, sie versucht, leidenschaftslos und objektiv zu sein. Ihre Mutterliebe macht die Mutter Europa blind: Aggression und Draufgängertum gelten ihr als Willenskraft und Charisma, der Wunsch, sich Fremdes anzueignen als jugendlicher Übermut, der sich auswächst, und das Verletzen von Grenzen als natürliche Folge von Größe. Die Schablone der großen Familie, die über die vom Blut nicht nur einer Generation getränkte Landkarte Europas gelegt wird, erlaubt es nicht, die Schreckgespenster von Kolonialismus,Totalitarismus und Rassismus zu sehen. Sie weckt falsche Erwartungen bezüglich der Menschlichkeit, Vernünftigkeit und Vorhersehbarkeit von Verhaltensweisen. Und so kommt es, dass das, was wir Europäer nicht bereit sind zu sehen, wofür wir auch keine Instrumente haben, um es zu beschreiben, was wir nicht in unsere Vorstellungswelt einlassen – für uns eben auch nicht existiert.

Und so kam es, dass wir Ukrainer vor den Toren der Normalität gelandet sind, außerhalb der zivilisierten Welt, im Randbereich einer Geschichte, die kategorisch abstrakt und allgemein denkt, und der unsere Verluste als statistisch vernachlässigbares Material gelten. Die ganzen vergangenen 16 Monate werde ich das Gefühl nicht los, wir seien Kandidaten in einem grausam-blutrünstigen Reality-Show-Format, das nach allen Regeln der Kunst gescriptet wurde: Das Publikum wird bei der Stange gehalten, indem der Grad der Gewalt immer weiter in die Höhe geschraubt und die Palette der Challenges für die Ukrainer stets um neue Aspekte erweitert wird. Den Handlungsverlauf hält man unkalkulierbar, die Auflösung wird aufgespart bis zuletzt. Ein adrenalingesättigtes Spiel ums nackte Überleben ist das, spannend für den unbeteiligten Zuschauer, der hautnah dran ist am Opfer, sich gruseln kann angesichts der Szenerien des Todes oder deren Echtheit in Zweifel ziehen, etwas glauben oder nicht glauben, debattieren, spenden, wegschauen, sich fragen, ob es schon Zeit ist, »Stopp« zu sagen. Ach du meine Güte, wir haben versäumt, uns auf das »Stopp« zu einigen, es funktioniert ja gar nicht!
Krieg ist keine Storyline, die man zurück auf Anfang setzen und umbauen könnte, damit sie anders verläuft oder die Toten neue Leben bekommen. Krieg ist keine Reality Show, kein LAN-Game und ganz sicher kein zivilisatorisches Experiment. Eure Kultur hat sich angewöhnt, euch vor unangenehmen Dingen abzuschirmen. Eure Sozialen Medien lassen sich konfigurieren, um unschöne und heikle Inhalte vor euch zu verbergen, was eure Menschlichkeit intakt halten soll. Dabei werden Grausamkeit und Aggressivität auf dem Unterhaltungsmarkt weiterhin stark nachgefragt, sorgen sie doch für Nervenkitzel und Adrenalinkick, erlauben es dem menschlichen Tier, sich lebendig zu fühlen. Das Wesen der Gewalt und des Bösen treibt Forscher und Künstler um, zwingt sie dazu, in den Abgrund des Schreckens zu blicken. Aber das alles nur, solange es in sicherer Distanz verbleibt, hinter dem Plasma eines Bildschirms, in einer Vergangenheit, die sich ganz bestimmt nie wiederholt. Bis vor kurzem lebten auch wir in der Ukraine in einer Welt, in der Krieg als Teil der Kultur galt. Ein echter Krieg ist das niemals.
Seit Beginn der vollumfänglichen russischen Aggression befinden wir uns in jemandes diabolischem Spiel, in einer unumkehrbaren Zeit, einer Wirklichkeit, die nach völlig inhumanen Regeln verläuft. Wir sind tödlich verletzt, getroffen von einem stets monströseren und heimtückischeren Bösen. Auch wir wünschen uns, uns davon zu distanzieren, uns abgrenzen zu können von diesem Bösen, nicht mittun zu müssen, nicht einsteigen zu müssen auf dieses Spiel, uns hinter eine Linie zurückziehen, hinter der wir sicher sind. Aber es hat sich gezeigt, dass es eine solche Linie für uns nicht gibt. Pazifismus und Menschlichkeit können nicht machen, dass dieser Krieg nicht existiert. Sie können nicht verhindern, dass er uns tötet. Sie retten uns nicht vor dem Sterben unserer Kinder, bewahren uns nicht vor dem Ökozid der bewusst herbeigeführten, globalen Katastrophe des gesprengten Staudamms von Kachowka. Die Ereignisse überstürzen sich in unvorhersehbarer Weise und reißen immer größere Stücke der Realität mit sich. Ich möchte euch keine Angst einjagen, das ist nicht mein Genre. Doch wie schrieb einst der Barockdichter John Donne: „jede weggespülte Scholle / lässt Europa schrumpfen – niemand lebt als Insel.” Hemingway lässt Donnes Motiv der Glocke wieder aufleben. Seine Glocke ist eine in Kriegszeiten, die einem jeden von uns die Stunde schlägt.
Hegel verstieg sich seinerzeit in den »Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie« zu dem Gedanken, in jeder Generation müsse es einen Krieg geben, läutert Krieg doch unser Denken und rückt unsere Vorstellungen von der Welt gerade, gibt uns Impulse für Neues und erhält im Übrigen auch die logische Struktur unserer Welt aufrecht. Verlassen wir seine Welt des unpersönlichen Theoretisierens und wenden uns den konkreten Realitäten zu, lässt sich kaum bestreiten, dass Krieg in der Tat eine äußerst schmerzhafte Form der Reinigung und Austilgung toter Wahrheiten, leerer Begriffe, überlebter Ideen und falscher Werte ist. Ja, er macht sozialen Wandel dynamischer, doch um den hohen Preis tausendfachen Todes und millionenfacher Flucht. Wir können theoretisieren, solange wir uns in sicherem Abstand dazu befinden, solange kein Krieg uns betrifft, so lange keiner unserer Lieben in einem Krieg umkommt. Im Krieg, mittendrin, auf seinem Territorium, lässt sich nicht theoretisieren.

Als existenzielle Krise bringt Krieg den Menschen in Situationen, in denen eine Wahl getroffen werden muss, wobei ganz oft weder Zeit noch Gelegenheit ist, Optionen zu wägen oder nachzudenken oder sich auch nur von den Umständen zu distanzieren, um sie angemessen beurteilen zu können … Faktisch ist hier also die Rede von einer Wahl, ohne die Wahl zu haben. Als wir uns mit dem Krieg konfrontiert sahen, kamen viele Menschen zunächst nicht von ihren humanistischen Ideen los. Der Krieg aber stellte sich als durch und durch inhuman, grausam und ungerecht heraus. Für mich persönlich waren gerade die ersten Wochen von Krieg und Brutalität eine Zeit, in der ich überdachte, was ich von der Generation meiner Großeltern gelernt hatte, und begriff, dass die Geschichten über den Horror, den das sowjetische NKWD in den Jahren 1939 bis 1941 in der westlichen Ukraine angerichtet hatte, nicht aufgebauscht gewesen waren, wie man manchmal hätte meinen können. So revidieren wir unsere Vorstellungen von Krieg, oder aktualisieren sie im Gegenzug und entwickeln ein neues Verständnis unseres Wissens über die Vergangenheit. Was kann ein Mensch dem Krieg entgegensetzen – ein konkreter Mensch einer konkreten Bedrohung seines Lebens, einem konkreten Verlust eines nahen Menschen, seines Zuhauses, der gewohnten Lebensweise …?
Der effektivste Mechanismus, den die Zivilisation bisher ersonnen hat, um Menschen und Gesellschaften davon abzuhalten, Krieg zu führen, ist Kultur. Ihr Einfluss ist im Vergleich mit anderen hemmenden Faktoren natürlich unvergleichlich komplexer. Kultur wirkt im Rahmen nicht nur einer Generation und immer unter strengen Vorgaben – nämlich mit dem Ziel, Gewalt einzudämmen, Streitfälle friedlich und ohne hegemoniale Ansprüche, Usurpation oder Übergriffe auf fremdes Territorium zu lösen. Kultur trägt darum Verantwortung. Ich erinnere mich an die zahlreichen Diskussionen mit russischen Autoren früher, in denen ich mir den Vorwurf gefallen lassen musste, die ukrainische Literatur sei politisch zu engagiert, unsere Schriftsteller seien über alle Maßen ideologisiert und konzentrierten sich nicht auf die reine Kunst, sondern auf gesellschaftliche Dynamiken, die eine derartige Aufmerksamkeit doch gar nicht verdienten. Allerdings hat sich, wie wir begreifen mussten, diese russische Selbst-Eliminierung aus der Sphäre eines präventiven, humanen Einflusses auf die Gesellschaft sowie dem Prozess der selbstverständlichen Weiterverbreitung der entsprechenden Werte als fatal herausgestellt. Besonders für uns hat sie schreckliche Konsequenzen gezeitigt.
Die Kultur diente in der häufig staatenlosen Ukraine schon seit den frühesten Zeiten der Kyjiwer Rus als Forum, um staatsbürgerlichen Positionen Ausdruck zu verleihen. Die Mehrzahl der Autoren des ukrainischen Barock etwa wollte die Chance auf Erlösung oder Selbsttranszendenz nicht nur in der religiös-spirituellen Praxis des Menschen verortet sehen, sondern auch in seiner aktiven Unterstützung bürgerschaftlicher Dynamiken, der Übernahme eines gewissen Maßes von Verantwortung und einem angemessenen Handeln. Darum liegen uns von einem Hetman Masepa Gedichte vor, und gibt es Kosaken-Chroniken, deren Autoren die rein menschengemachte Dimension der Geschichte verstehen und veranschaulichen, dass du dich nicht selbst nicht retten kannst, ohne nicht auch gut für deine Mitmenschen zu sein. Ein gutes Beispiel dafür ist Hryhorij Skoworoda: Er lebte isoliert, aber in dem Bewusstsein, dass jeder und jede dem je eigenen moralischen Imperativ folgen muss.
Die nach Beginn der vollumfänglichen russischen Invasion in der Ukraine entstandene Lyrik ist nach meinem Empfinden vergleichsweise direkt, bar der künstlerischen Spielereien, ohne Allusionen, Metaphern oder andere poetische Schnörkel. Es ist eine Lyrik der emotionalen Tatsachen, die ganz bewusst eine simple, konkrete und eindeutige Sprache anstrebt. Sie hat etwas Dokumentarisches an sich, ist durchsichtig wie die Linse eines Objektivs, die ja auch die Aufmerksamkeit nicht auf sich selbst lenken will. Dennoch bleibt auch diese Lyrik in der Formensprache des poetischen Ausdrucks verankert, worin die Worte miteinander in Beziehung treten und mehr bedeuten, als in einem publizistischen oder einem Gesprächszusammenhang. Verantwortung und Gewicht der Worte haben zugenommen. Bei uns bringt jedes Wort sehr viel mit sich.
Für die umfangreichere Form der Prosa hingegen braucht es mehr Zeit und mehr Abstand zum Geschehen. Ein Roman oder eine Erzählung verlangen vom Autor, sich in das Material hineinzuvertiefen, bis er oder sie sich zu gegebener Zeit davon wieder lösen muss, wie von jeder beliebigen faktischen Realität auch, um sich dann dazu als zu einem künstlerischen Material verhalten zu können, das nicht mehr aufwühlt oder schmerzt, nichts triggert, das gemischt werden kann wie ein Deck Karten, um die Spielregeln festzulegen und die Jokerrollen zu verteilen. Solange deine aktuelle Realität aber derart intensiv und schmerzhaft ist, solange wirst du dich auch nicht von deinem Schmerz distanzieren oder dem mit einem »Stopp!« Einhalt gebieten können, was dich schier umbringt. Und solange kannst du auch keine gute Prosa schreiben. Die meisten Romanautoren sind derzeit dabei, bewusst oder unbewusst Material zu sammeln, indem sie sich Notizen machen, Tagebuch schreiben, die Dinge intensiv erleben und in Erinnerung bewahren. So mancher wirft sich unbewusst auch mit aller Kraft in den Strudel der Ereignisse, weil sich so wohl am besten erspüren und begreifen lässt, was gerade geschieht. Viele gehen dahin, wo es weh tut. Jeder Eindruck ist wertvoll. Doch um dieses Material zu verarbeiten und daraus ein stimmiges Kunstwerk »hervortanzen« zu lassen, mit einem durchdachten Plot, einer Riege von Figuren und einer kunstvoll arrangierten Konfliktdramaturgie braucht es innere Ressourcen. Unser Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis ist derzeit aber mit anderen Dingen besetzt. Mitten drin in diesem Krieg agieren wir auf der Ebene des Überlebens. Die Wirklichkeit zwingt uns konstant, auf Alarmsignale zu achten, uns auf plötzliche Lageveränderungen in unserer Umgebung wie im eigenen Gefühlshaushalt einzustellen und mit jeder Menge Situationen klarzukommen, für die es keine Blaupause gibt.
Es ist sehr schwer und meist unmöglich, gefühlsmäßig unberührt zu bleiben, wenn der Newsfeed wieder Informationen über hunderte von Toten oder heftigen Beschuss auswirft. Etwas Entsetzliches geschieht oder wir sehen uns ein traumatisierendes Video an, und schon haben wir den Ort in uns vergessen, von dem aus wir zuvor die Welt betrachtet haben, so dynamisch verändern wir uns. Große Prosa wird daher etwas für die Zukunft sein, wenn wir uns wieder konzentrieren und analysieren können, was uns da zugestoßen ist und wie wir uns dadurch verändert haben. Dann werden wir auf all unsere Überlegungen und all die Materialien zurückkommen, die derzeit an den Rändern unseres Bewusstseins und in den blinden Flecken unserer Erinnerung eingelagert sind.
In der Zeit zwischen 2014 und 2022 wurden in der Ukraine etliche literarische Arbeiten über den Krieg vorgelegt. Die Literatur verstärkte, was mediale Ressourcen an Inhalten vermittelten und fungierte häufig als Bekräftigung und Nachschärfung der Argumente. Es stimmt traurig, dass diese Kriegsliteratur bis auf wenige Ausnahmen im Westen kaum präsent ist. In der Ukraine war damals niemandem so recht klar, wie und in welchem Umfang dieser Krieg literarisch thematisiert werden konnte und sollte. In Schriftstellerkreisen bestanden gewisse Vorurteile gegen »Veteranenliteratur«, die angeblich unzureichend professionell war. Doch war es vielmehr so, dass sich die »professionelle« Literaturszene unzureichend für das Kriegsthema engagierte. Für Kriegslyrik fand man nur schwer einen Verlag oder ein Publikum, das sie wirklich verstand oder schätzte, diejenigen einmal ausgenommen, die in diesem Krieg gekämpft oder Freiwilligendienste geleistet hatten oder direkt davon betroffen gewesen waren. Heute ist das Kriegsthema auf tragische Weise in die Literatur eingebrochen. Der Krieg steht Millionen von Menschen vor Augen und hat alles, was wir aus der bisherigen Literatur und Kunst über Krieg zu wissen glaubten, entweder aktualisiert oder radikal in Frage gestellt.
Literatur kann nicht in einem Vakuum existieren. Weder wird sie ausschließlich für die Ewigkeit verfasst, noch kann sie nur nach Reinheit streben. Gesellschaftliche und politische Ereignisse, Kriege und historische Herausforderungen kann sie ebenso wenig ausblenden, wie die Wirklichkeit als solche. Vielmehr muss sich gerade die Literatur ins Getümmel stürzen, den Finger in die Wunde legen, dem einen Sinn geben, was einem nicht in den Kopf will und die Fragen beantworten, die zu stellen es schon des Mutes bedarf. Denn, wie sich herausgestellt hat, ist ein Krieg ein Prüfstein für Menschlichkeit und Authentizität. In Literatur und Kunst ebenso wie im persönlichen Wertekanon.
Mit Beginn des vollumfänglichen Angriffskrieges sahen sich viele von uns vor die Frage gestellt, was einem persönlich wichtig ist, wovon man sich auf keinen Fall lossagen würde, wo das Äußerste liegt, bis zu dem man gehen würde. Machen wir uns keine Illusionen – jeder hat seine eigene Werteskala, jede ihre eigenen Erfahrungen und Lebensumstände und nicht jeder versteht die Entscheidungen der anderen. Aber ausnahmslos alle von uns (sogar die, die die Ukraine sofort verlassen haben), haben die Auswirkungen des Krieges in irgendeiner Form am eigenen Leib erfahren. Manche hat er mehr, manche weniger einschneidend getroffen, aber vor uns allen liegt viel Arbeit, um dieses kollektive Trauma auf eine Erfahrungsebene zu überführen, auf der es nicht mehr wehtut, wo wir damit leben können und auch andere nicht retraumatisieren oder verletzen … Doch je traumatisierter wir werden, desto schwerer fällt es, unser Trauma zu erklären, umso weniger möchten wir darüber sprechen oder gar beweisen müssen, wie schwer oder schmerzhaft das Erlebte war und ist. Für Ausländer ist es viel leichter, die Menschen in Russland und ihre Probleme mit den Sanktionen zu verstehen (man kann nicht zu McDonalds gehen, kein iPhone kaufen und nicht in den Urlaub fliegen), als die hochgradig komplexen ukrainischen Erfahrungen nachzuvollziehen (wie das Begraben von Verwandten im Hof eines Wohnblocks, eine Massenvergewaltigung, die Grenzerfahrung der Folter und dergleichen mehr). Genau diese Erfahrungen zugänglich zu machen, damit sie über die literarische, filmische künstlerische Bearbeitung für andere nachvollziehbar sind – das kann nur die Kultur. Kunstwerke filtern aus schweren Erfahrungen die prägnanten Aspekte heraus. In einem einzigen, beredten künstlerischen Detail kann die ganze Wucht der Tragödie beschlossen sein und sich ein Weg in die Katharsis eröffnen.
Das absolute, gesichtslos abstrakte Böse (oder auch Gute) gibt es nicht. Immer ist da eine menschliche Dimension. Immer ist eine bestimmte Person verantwortlich. Im Christentum wie auch in anderen Weltanschauungen vollzieht sich die Entscheidung zwischen Gut und Böse und der Kampf darum im Inneren des Menschen – ständig wieder, jede Sekunde neu. Jederzeit gilt es, wachsam zu sein und zu prüfen, ob man sich für das Gute entscheidet. Die in unserer Kultur verwirklichten Werte erinnern uns an die Möglichkeit dieser jeden Tag erneut zu treffenden Entscheidung. Wenn wir uns auf die Ebene der Abstraktion begeben, eine neutrale Position einnehmen, über die Situation erhaben sein und uns aus dem Konflikt oder der Konfrontation herausnehmen wollen, dann beanspruchen wir faktisch die Position Gottes oder den Standpunkt eines reinen moralischen Imperativs. Damit aber verlieren wir aber unseren ganz persönlichen inneren Zweikampf zwischen Gut und Böse. Jedes »das geht mich nichts an« erkennt das Recht des Stärkeren an und bedeutet ein Reinwaschen der Hände mit dem Verweis auf Hygienezwecke.
Krieg prüft die Literatur auf ihre Authentizität und zieht ihre Existenzberechtigung in Zweifel. Doch zeigt sich die Macht von Literatur gerade darin, dass sie dazu beiträgt, im Menschen das Menschliche zu erhalten und Menschen dabei zu helfen, zu widerstehen, sich dem Bösen zu widersetzen. Ihre Macht hat Literatur auch darin, den Verzweifelten ein Refugium zu sein und denjenigen eine Hoffnung, die mehr verloren haben, als sie an innerer Stärke aufbieten können. Literatur kann Heimstatt sein für jemanden, der sein Heim verloren hat, kann das Kreuz auf jemandes Grab sein, dessen Leichnam nie gefunden wurde, um bestattet zu werden. Sie kann ein Wunder bezeugen und Zeugenschaft für die ablegen, die nicht dabei waren. Diese Macht wächst der Literatur in Zeiten des Krieges von den Menschen zu, die den Krieg durchleben. Manchmal ist die künstlerische Antwort die einzig mögliche Art, sich zu einer Realität zu verhalten, die die Fundamente der nackten Existenz untergräbt.
Wie die meisten von uns, so kann auch ich mich zu diesem Krieg noch nicht wie zu einem beliebigen Material verhalten, kann ihn noch nicht von mir ablösen. Wir alle sind mittendrin in diesem Krieg, wir sind von ihm betroffen. Wir haben daher eine sehr subjektive und spezifische innere Optik, der es gerade eben so gelingt, festzuhalten, was sich abspielt. Momentan das Wichtigste für uns ist durchzukommen. Wir leben im Modus von Kampf und Überleben. Für künstlerische Distanz oder Reflexion nicht gerade der geeignetste Zustand. Es fällt schwer, ein Bild zu analysieren, das man nicht ganz, sondern nur in einem Ausschnitt sieht, schlaglichtartig, fragmentiert oder verwischt. Das menschliche Hirn macht sich daran, in diesem Bild nach Anzeichen für Normalität zu suchen, die Ausnahmesituation irgendwie zu ordnen. Weil es die einzige Möglichkeit ist zu überleben.
Gleichzeitig erlebe ich, wie unsere Literatur zu ganz primitiven, basalen Funktionen zurückkehrt. Es sind dies keine Funktionen des Ästhetischen, auch keine von Genuss oder Unterhaltung, sondern Formen des Gebets, der Beschwörung, des Fluchs, des Bekenntnisses oder Totengedenkens. Allesamt Phänomene und Funktionalitäten, die auch die ursprüngliche, synkretistische Poesie schon kannte. Was im Zuge der Weiterentwicklung von Gesellschaften und der Ausdifferenzierung von Kulturen atrophiert ist, kommt in Zeiten des Krieges wieder zum Vorschein. Die ukrainische Lyrik gewinnt in diesem Krieg eine unerwartete Stärke, die sie von Fundamentalem und Archetypischem sprechen lässt, über Tiefen des menschlichen Geistes und der menschlichen Existenz, in die professionelle Dichter schon lange keinen Fuß mehr zu setzen wagten.
Ich möchte auch noch erwähnen, dass die ukrainische Lyrik aktuell äußerst reich an Formen und Bildern ist und einen außergewöhnlichen Aufschwung erfährt. Alles, was die ukrainische Literatur derzeit hervorbringt, von den stärksten und qualitativ hochstehendsten Texten bis zum reinen, simplen, bekenntnishaften Aufschrei, bezeugt einzigartige Prozesse, die unser literarisches Schaffen auf Jahrzehnte hinaus prägen werden. Menschen, die noch niemals etwas Poetisches geschrieben haben, fangen jetzt zu dichten an, und oft sind gerade ihre Arbeiten besonders stark. Sie mögen sich fernab jeder ausgefeilten Formensprache bewegen und bloßes Bekenntnis sein, doch ihre Aufrichtigkeit und Spontaneität machen Schwächen und mangelnde Professionalität vergessen. Anhand dieser spontanen poetischen Formen wird man später einmal nachvollziehen können, wie sich Literatur im Allgemeinen und Lyrik im Besonderen in den außergewöhnlichen und schweren Zeiten eines Kriegs entwickeln.
Unsere Wirklichkeit stellt uns jetzt viel Material für die Fremd- und Selbstbeobachtung zur Verfügung, insbesondere dazu, wie sich Menschen in Kriegs- und Krisenzeiten verhalten. Krieg verändert den Menschen. Häufig in einer Weise, die nicht mehr rückgängig zu machen ist. Für mich persönlich steht die traumatische Qualität dessen, was wir gerade durchleben, im Vordergrund. Worte wirken in traumatische Erfahrungen direkt hinein, indem sie die Dinge beim Namen nennen. In der einen oder anderen Weise hat dieser Krieg jede und jeden von uns psychisch traumatisiert, ganz zu schweigen von denen, die er auch körperlich verletzt hat. Ein literarischer Text kann Wege aus dem Trauma aufzeigen.
Und so möchte ich mit einem Gedicht darüber schließen, was Literatur für mich ist, denn das letzte Wort soll der Poesie gehören.«
Kann ich die zwei Schritte noch gehen oder bleibe ich stehen hier –
über den in unnatürlicher Haltung verstreuten Leibern
über den klaffenden Löchern im Rost eines ausgebrannten Autos
von Geschossen zu groß, um jemand bestimmten zu töten.
Die Unwirtschaftlichkeit künstlerischer Ressourcen, die Welt wird nichts davon glauben.
Das Fehlen eines schlüssigen Motivs, erklär mir, warum sie euch töten, sagst du,
es muss doch einen Grund geben. Aus so einem Plot würde niemals ein Buch.
Solange es noch Literatur ist, besteht immer die Möglichkeit, rechtzeitig stehen zu bleiben,
nicht auf Tuchfühlung zu gehen, wo sich den Augen zu viel zeigen würde –
wie sie aussehen, der abgebrochene Nagel an der gepflegten Frauenhand,
der Kinderschuh unter den Überbleibseln eines Hausstands.
Literatur sollte doch dazu da sein, es gar nicht erst kommen zu lassen zu dem, was da geschah –
auf Prävention zu setzen, das Schlimmste zu verhindern, den zu verändern,
der Nichtwiedergutzumachendes anrichten könnte.
Sie ist doch gerade nicht dazu da, im Nachgang weiszumachen,
ein einsamer Kinderschuh hätte nichts mit einem Kinderfuß zu tun,
und der abgebrochene Nagel der Frau – sei eben ihr abgebrochener Nagel, kein großes Ding.
Rechtzeitig stehenbleiben, nicht zu nah rangehen, nicht hinsehen.
Rettende Distanz der Kunst, Leitplanke der Glaubhaftigkeit, bis zu der alles
noch weit hergeholter Plot sein kann, verbotene Ausgeburt einer Fantasie
in Katastrophenstimmung.
Literatur ist nicht länger Fluchtroute, sie ist Abstellgleis,
von dort kommst du nirgendwo hin. Du steigst in den Zug, nimmst dir ein Buch vor –
und verstehst: Dieser Zug – fährt nicht an, fährt nicht zum Ziel, fährt nicht ein
da im Menschen, wo er noch Entscheidungen treffen kann –
abreisen für immer und nie mehr wiederkommen
oder die Notbremse ziehen und aufs Ganze gehen.
Einmal, bei Not am Mann, werdet ihr die Spur wieder aufleben lassen,
werdet die Rammböcke abbauen, euch gestatten hinzusehen.
In einer Welt, in der Literatur nicht dazu da ist, zu töten, und nicht dazu, Rechnungen
zu begleichen,
und nicht dazu, mit Spam zu fluten, und nicht dazu, bis aufs Jota alles zu erinnern,
und nicht dazu, die Wirklichkeit in ihren abstoßendsten Formen zu fixieren.
So eine Literatur ist zu gar nichts da, hörst du.
Der Kinderschuh, der mitsamt Kind durch die Luft flog, als beide mit splitterndem Glas
und Beton verwirbelt wurden,
der abgebrochene Nagel an der Frauenhand unterm Schutt, unverpixelt das,
was vom Körper übrig blieb,
das Kinderbuch, das du anstarrst, um den Rest nicht wahrzunehmen,
dir den Rest nicht vorzustellen, der da war zwischen Buch und Hand,
zwischen dem Samstagmorgen einer Familie und dem nächsten Bild.
Gehst du zu nahe heran, durchbohrt dich der Bewehrungsstahl
mit jemandes ersticktem Schrei unterm Schutt
»Ich will nicht sterben«. Literatur ist dazu da, diesen Schutt rechtzeitig wegzuräumen.
Literatur ist dazu da, uns aufzuzeigen, wie wir weiterleben können,
mit diesem Schrei im Ohr, mit der Frauenhand, dem Kinderschuh in Nahaufnahme,
wissend, was dahinterstand in der unzensierten Version der Wirklichkeit,
die keine künstliche Intelligenz für uns weichzeichnet.
Dazu. Dazu war Literatur immer schon da.